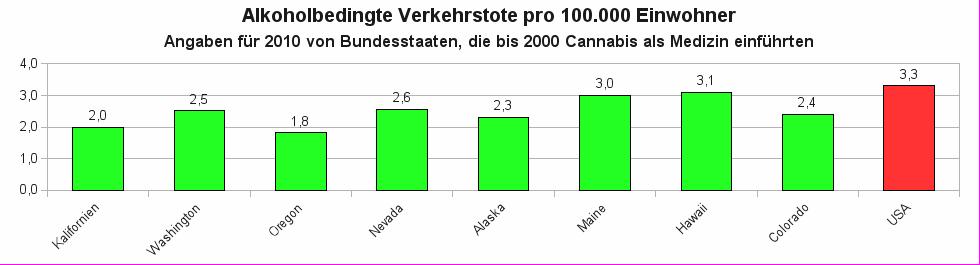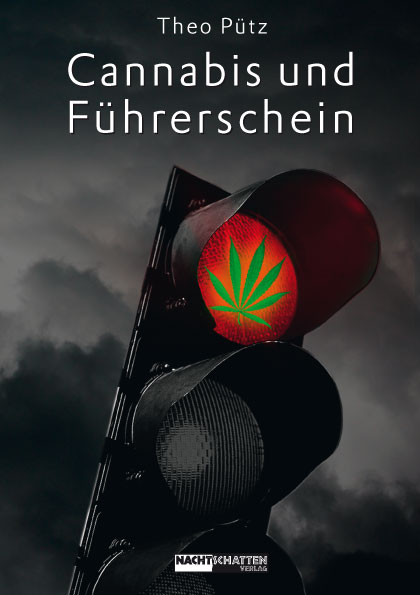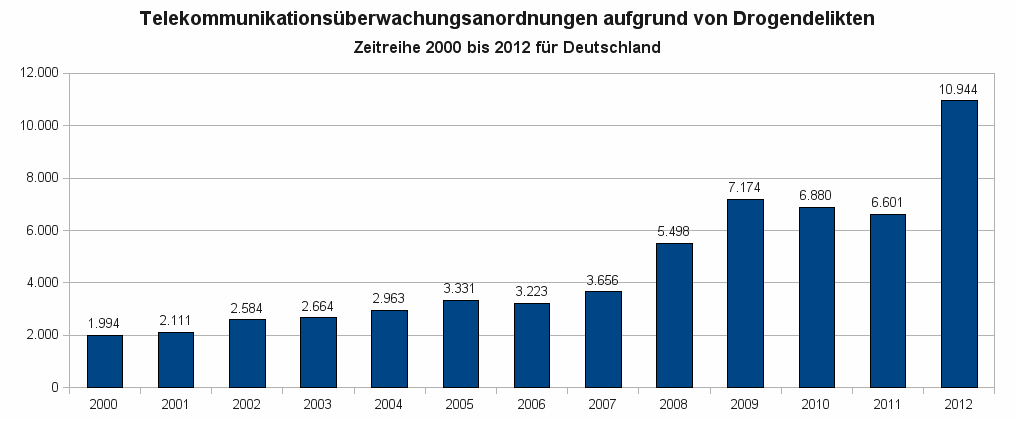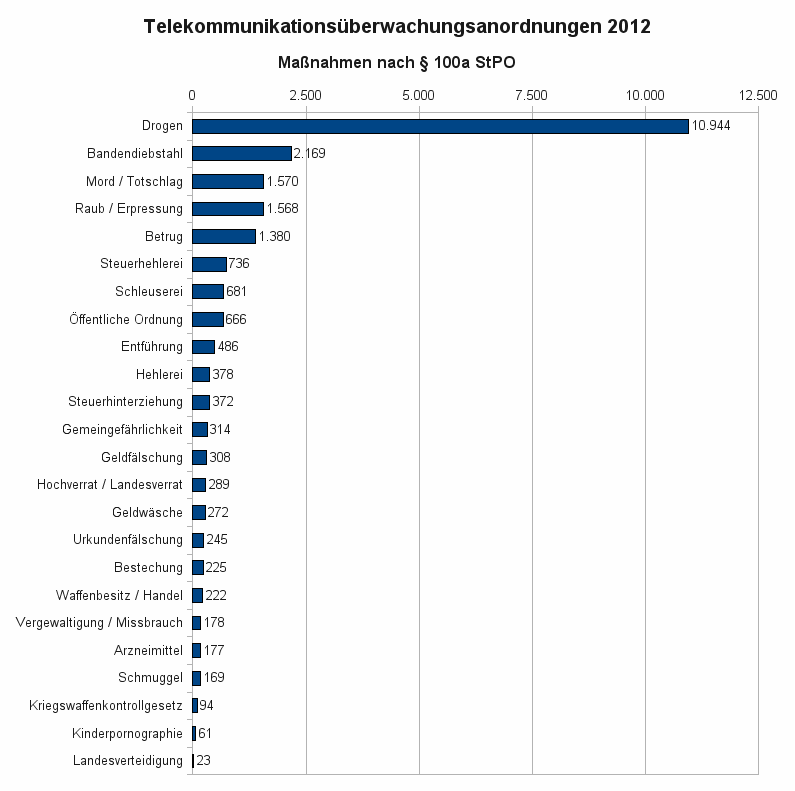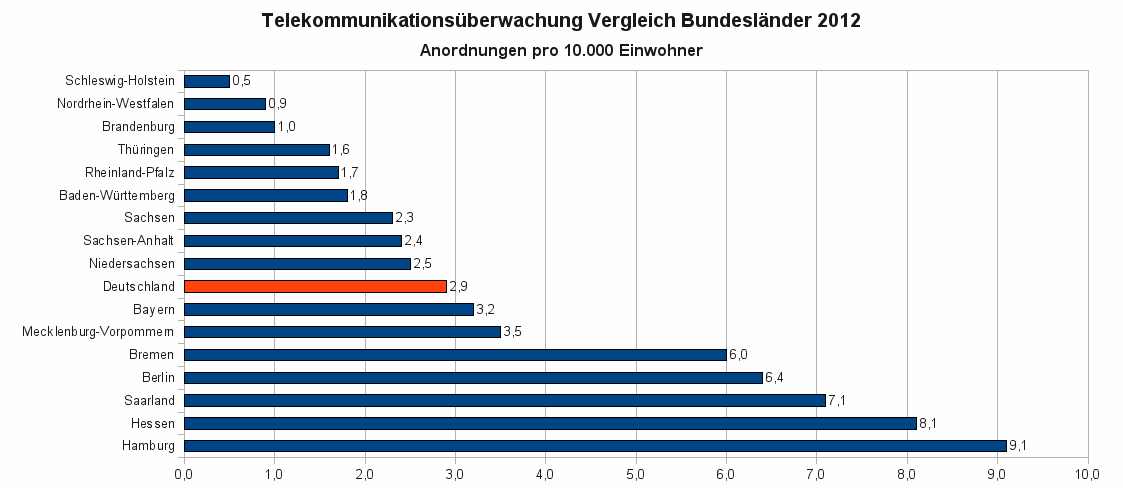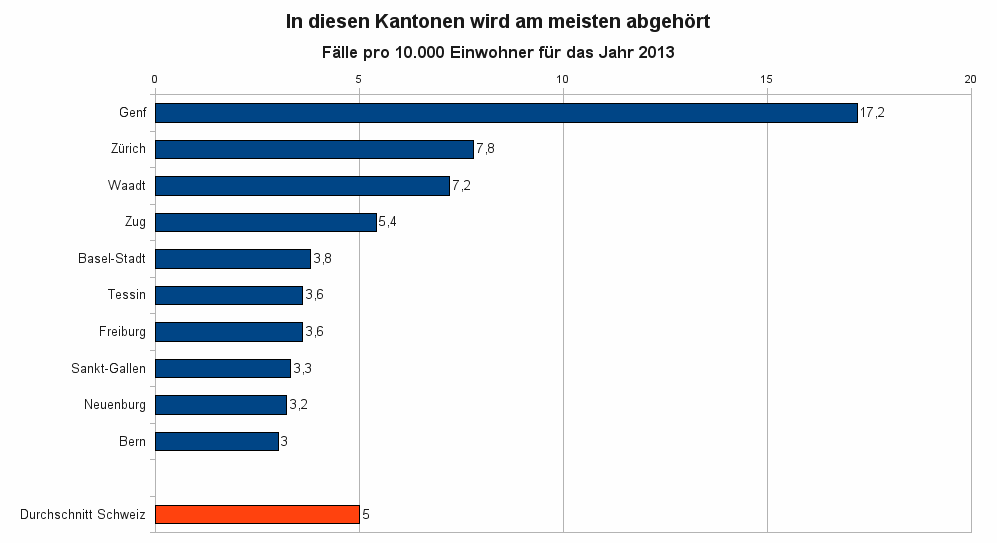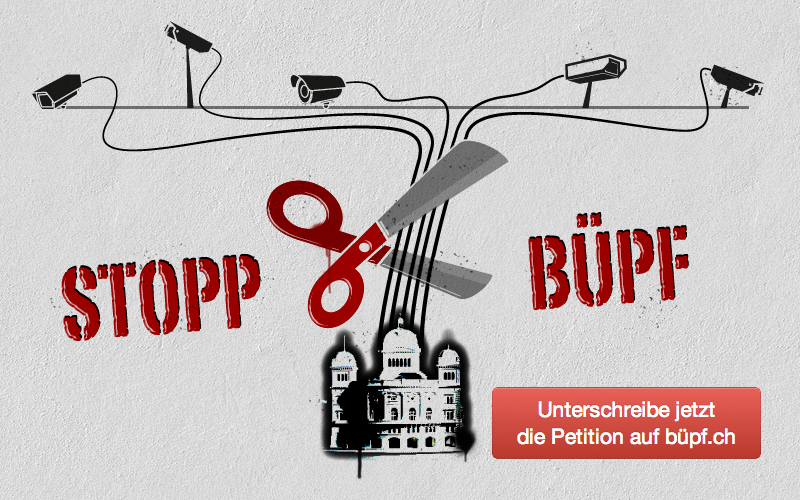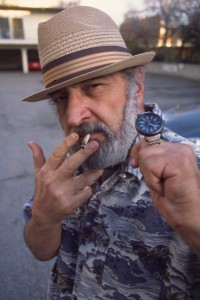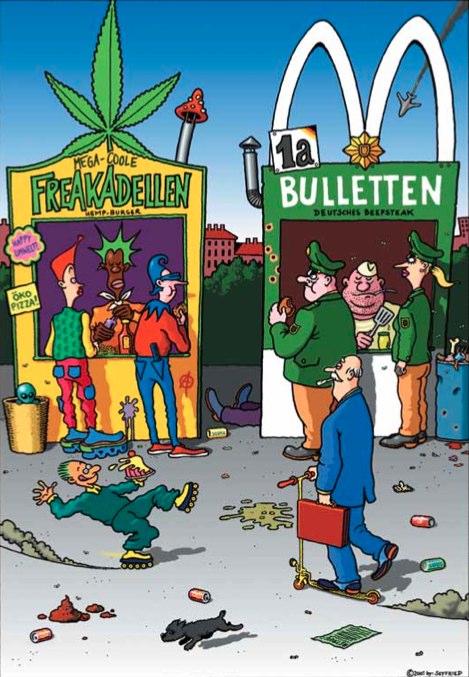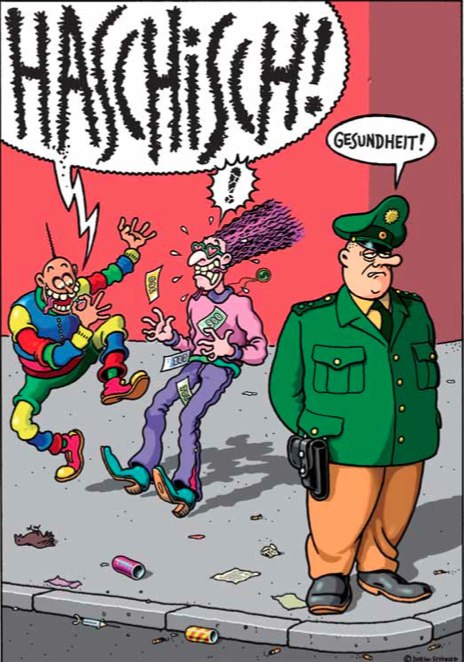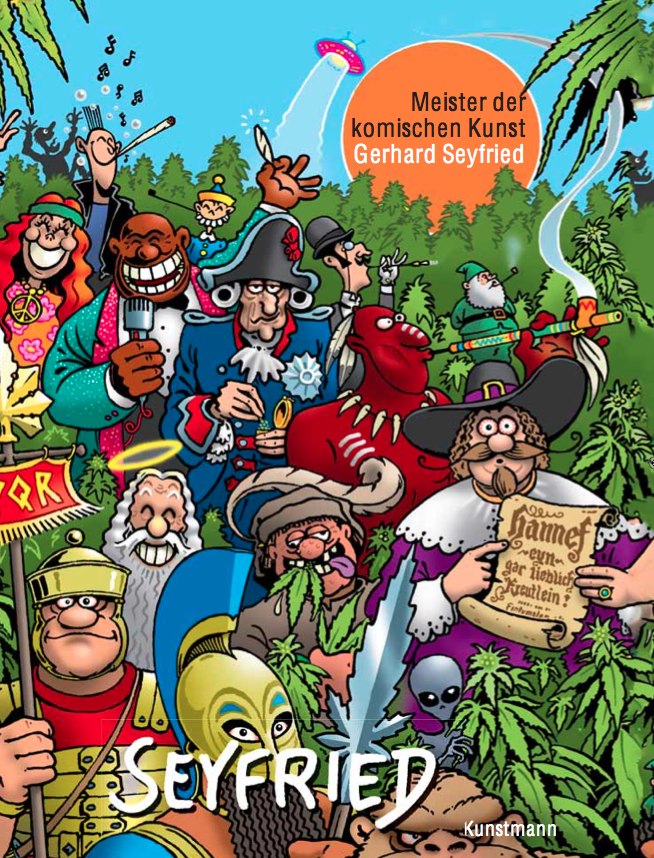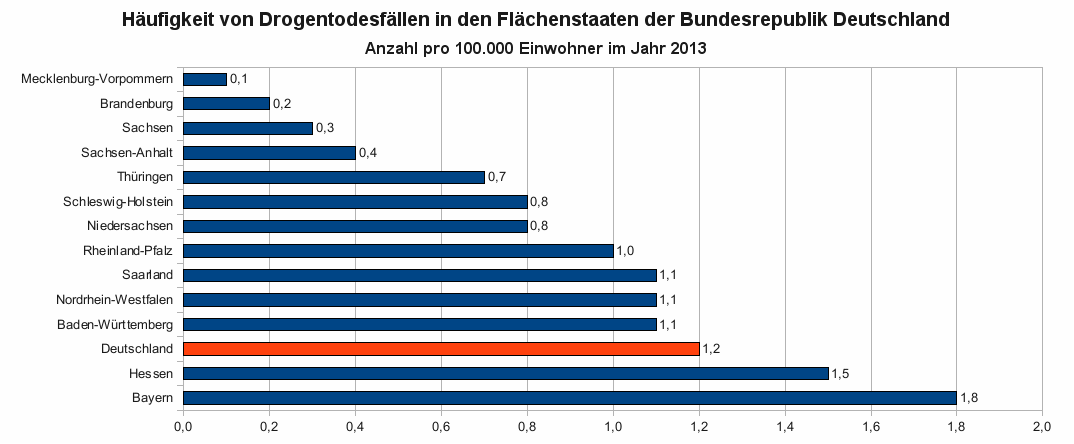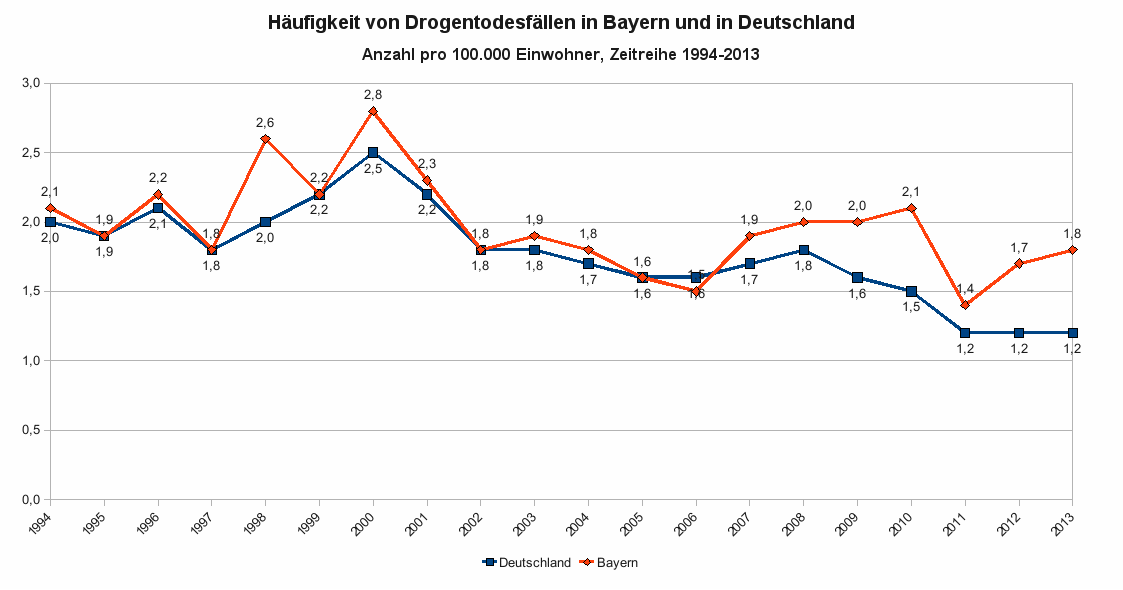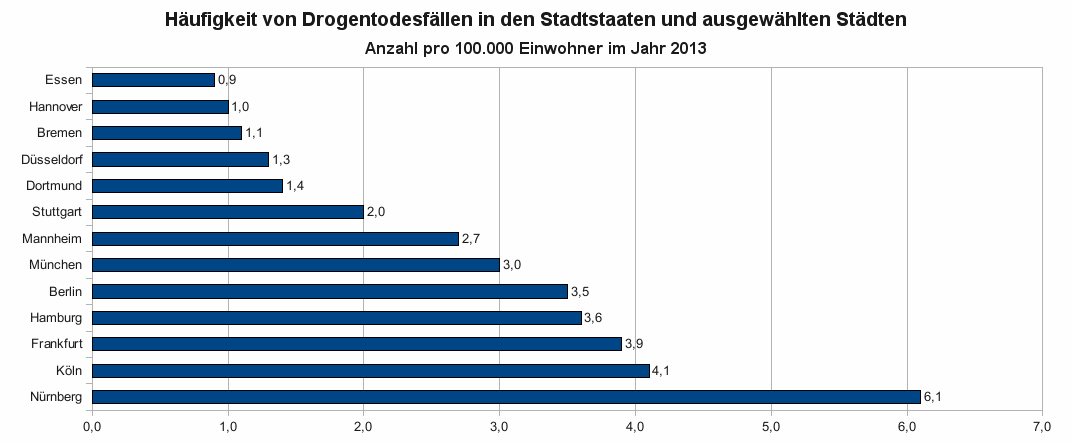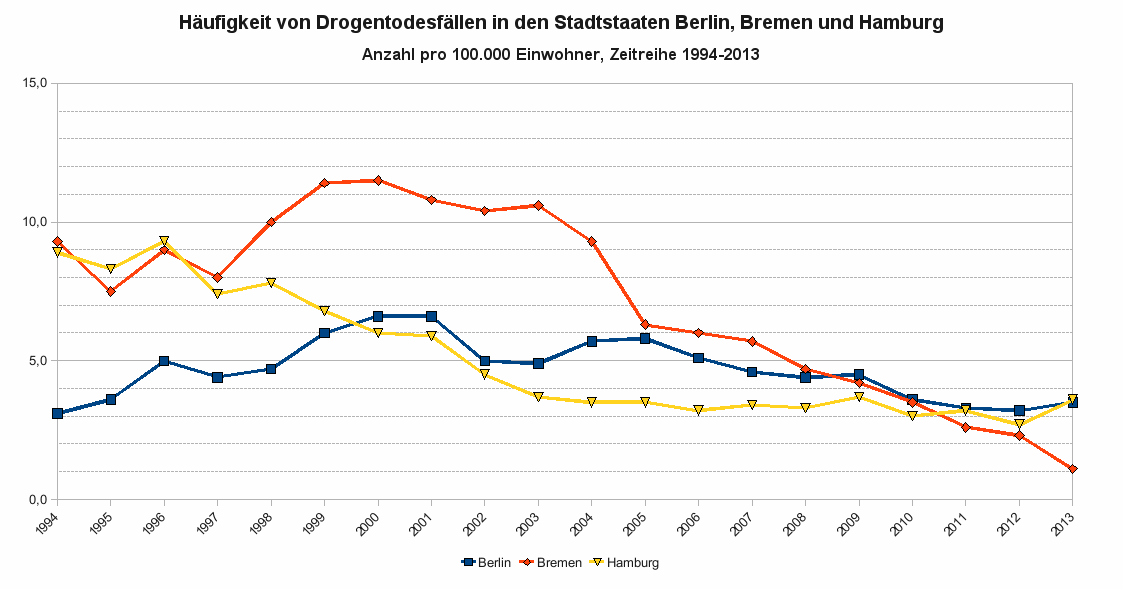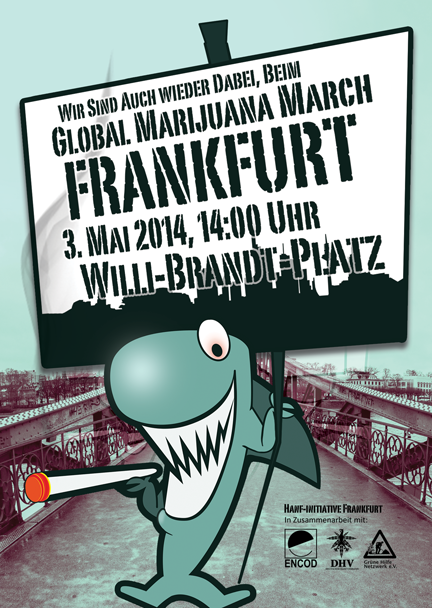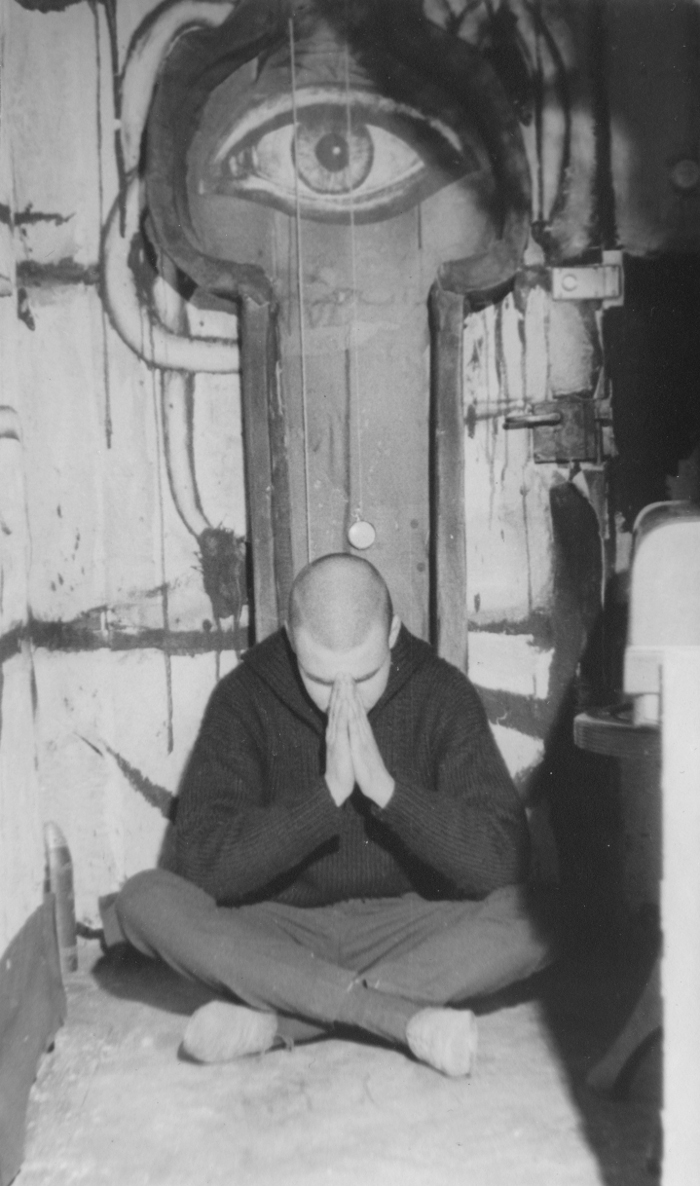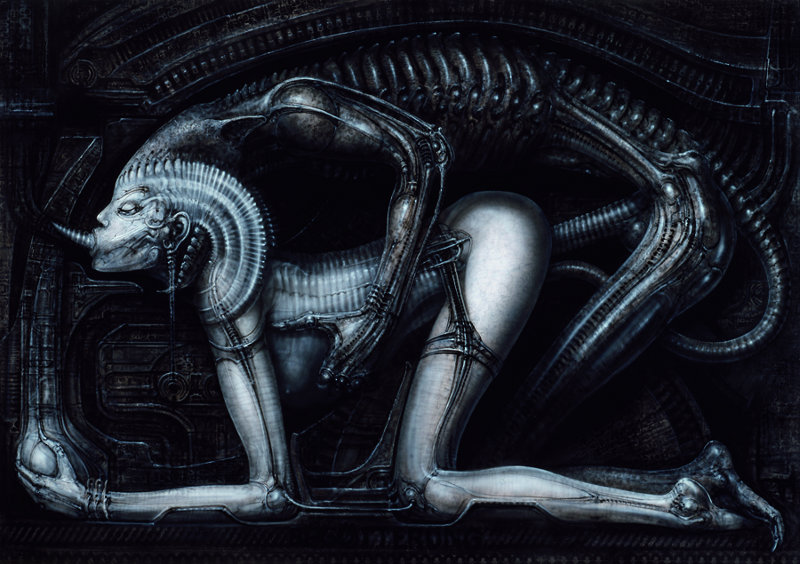Am Montag, 16. Dezember 2013, veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine in ihrem Feuilleton einen Artikel von Oliver Tolmein unter dem Titel „Drogenfreigabe – Auch Ernst Jünger würde sich freuen“. Zu Beginn des Artikels heißt es wörtlich: „Drogenkonsum ist bei uns strafbar. Fast vierzig Prozent aller deutschen Strafrechtsprofessoren erklären diese Konzept jetzt als „gescheitert, sozialschädlich, unökonomisch“. Sie fordern: Legalize it!“
Nicht wahr ist die Feststellung, dass der Drogenkonsum bei uns (in Deutschland) strafbar ist. Der Erwerb und Besitz diverser Drogen ist in Deutschland strafbewehrt, der Konsum selbst ist in Deutschland – im Gegensatz zur Schweiz – nicht verboten und kann aus verfassungsrechtlichen Gründen auch nicht verboten werden. Wahr hingegen ist die Feststellung, dass das Konzept der Verbotspolitik „gescheitert, sozialschädlich und unökonomisch“ ist. Mit dieser Einsicht sind die Strafrechtsprofessoren in guter Gesellschaft mit der Weltkommission für Drogenpolitik (Global Commission on Drug Policy), die in ihrem Bericht vom Juni 2011 feststellten: „Der weltweite Krieg gegen die Drogen ist gescheitert, mit verheerenden Folgen für die Menschen und Gesellschaften rund um den Globus. 50 Jahre, nachdem die Vereinten Nationen das Einheits-Übereinkommen über die Betäubungsmittel initiiert haben, und 40 Jahre, nachdem die US-Regierung unter Präsident Nixon den Krieg gegen die Drogen ausgerufen hat, besteht in der nationalen und weltweiten Drogenpolitik dringender Bedarf nach grundlegenden Reformen.“
Mitwirkende an diesem Bericht waren u.a.: Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen; Louise Arbour, ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte; Javier Solana, ehemaliger Generalsekretär für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union und Ruth Dreifuss, ehemalige Bundespräsidentin der Schweiz und Vorsteherin der Eidgenössischen Departements des Innern.
Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und –professoren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages
In der von mehr als 100 Strafrechtsprofessorinnen und –professoren unterzeichneten Resolution wird die Einsetzung einer Enquête-Kommission zur Evaluierung der Drogenpolitik gefordert. Von der Notwendigkeit einer Überprüfung der Wirksamkeit des Betäubungsmittelgesetzes sind die Unterzeichnenden überzeugt und wollen den Gesetzgeber auf die unbeabsichtigten schädlichen Nebenwirkungen und Folgen der Kriminalisierung bestimmter Drogen aufmerksam machen. Sie wollen das Parlament anregen, bezüglich dieser Thematik seinem verfassungsrechtlichen Auftrag im Allgemeinen und den wissenschaftlich begründeten Prinzipien von Strafgesetzgebung und Kriminalpolitik im Besonderen durch die Einrichtung einer Enquête-Kommission Rechnung zu tragen. Sowohl aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht als auch aufgrund empirischer Forschungsergebnisse besteht die dringende Notwendigkeit, die Geeignetheit, Erforderlichkeit und normative Angemessenheit des Betäubungsmittelstrafrechts zu überprüfen und gegebenenfalls Vorschläge zu Gesetzesänderungen aus solcher Evaluation abzuleiten.
Im Fazit der Resolution heißt es, dass der Staat die Bürger durch die Drogenpolitik nicht schädigen dürfe. Es sei deshalb notwendig, Schaden und Nutzen der Drogenpolitik unvoreingenommen wissenschaftlich zu überprüfen. Wörtlich heit es dann weiter: „Als Kriminalwissenschaftler fühlen wir uns in besonderem Maße verantwortlich für die Einhaltung strafrechtstheoretischer Prinzipien und für die Zurückhaltung des Staates in der Anwendung der ultima ratio gesellschaftlicher Steuerung. Deshalb appellieren wir an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, nicht nur dem Fraktionszwang zu folgen, sondern auch ihrer individuellen Verantwortung.“
Bei dieser Resolution an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages handelt es sich nicht um eine Petition. So schrieb Prof. Dr. Lorenz Böllinger, Sprecher der Resolution, an den Autoren dieses Artikels am 2. Januar 2014 im Wortlaut: „Durch Herrn Wenzel, einen ehemaligen (ca. 2001) wissenschaftlichen Mitarbeiter, wurde die vom Schildower Kreis initiierte Resolution deutscher Strafrechtsprofessoren eigenmächtig und ohne Autorisierung als Petition an den Bundestag eingereicht. Dies beschädigt die eigentliche Zwecksetzung der Resolution. Es geht nämlich um die Überzeugung von Bundestag-Abgeordneten, aus dem Parlament heraus eine Enquête-Kommission zu beantragen. Wenn – bisher – 25% der Abgeordneten dies beantragen (kein Fraktionszwang!), muss eine solche Kommission eingerichtet werden, welche dann gründliche Anhörungen von Experten durchführen muss, und zwar zur gesamten Drogenpolitik. Diese ureigenste Initiative und Aktivität des Parlaments muss von innen kommen, nicht durch eine Petition von außen gleichsam aufgedrängt. Wir agieren da mit verschiedenen Strategien und man sollte die nicht vermischen. Außerdem kriege ich Probleme mit den Resolutionsunterzeichnern, die mir vorwerfen, fahrlässig mit ihren Unterschriften umgegangen zu sein. Es kann passieren, dass die ganze Sache daran scheitert. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dies auf Ihrer Homepage vermitteln könnten.“
Petition: Deutschlandweite Legalisierung von Cannabis unter staatlicher Kontrolle
Ziel dieser Petition, die von Andreas Unger iniziiert und am Jahreswechsel bereits von mehr als 30.000 Personen gezeichnet wurde, ist eine deutschlandweite Legalisierung von Cannabis und dessen Produkte. Dies gilt sowohl für dessen alltäglichen Konsum als auch für den medizinischen Einsatz. Gefordert wird, dass in ganz Deutschland eine einheitliche Regelung gefunden wird, die den Erwerb von Cannabis für jede Person ab 18 Jahren erlaubt und den Anbau sowie den Verkauf in staatlich zertifizierten Unternehmen regelt. Es geht dabei nicht um Probeprojekte in einzelnen Städte oder vom Staat bzw. Gemeinden finanzierte Projekte oder Projekte für bestimmte Vereine oder Clubs, wie in der letzten Zeit häufiger gefordert wurde, sondern es geht um die generelle und einheitliche Legalisierung in ganz Deutschland.
Auch wenn die Petition recht holprig formuliert ist und Cannabis Social Clubs keine Erwähnung finden, so weist sie doch in die richtige Richtung. Sicher ist die folgende Forderung in der Petition fragwürdig: „Auch sollte der private Anbau weiter Verboten sein ebenfalls wie der Ex- und Import. Nur so kann eine Qualität gesichert werden.“ Vernünftig ist jedoch die Forderung, dass der Anbau in staatlich zertifizierten Unternehmen erfolgen sollte und auch der Handel in staatlich zugelassenen Unternehmen durchgeführt werden sollte. Nur so könne der THC und CBD Gehalt genau bestimmt werden und sichergestellt werden, dass keine Verunreinigungen enthalten sind. Cannabis Social Clubs müssten somit gemäß dieser Petition staatlich zertifizierte Unternehmen sein, also einem staatlich vorgegebenen Kriterienkatalog entsprechen und einem Kontrollmechanismus unterliegen.
Auch wenn die Petition gewisse Mängel aufweist und zudem auch mehrere Rechtschreibfehler enthält – ja nicht jeder, der sich politisch engagiert, ist Akademiker –, kann man jedoch mit seiner Unterzeichnung kundtun, dass man prinzipiell für eine Legalisierung von Cannabis ist. Die Petition flankiert jedenfalls die Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und –professoren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages umso besser, je mehr Leute die Petition unterzeichnen.
Zur Petition hier klicken
Zur Fratzenbuchseite der Petition hier klicken
Lorenz Böllinger: Die gesellschaftliche Drogenphobie
Lorenz Böllinger: Über die Amoral der Extase
Encod: Manifest für eine sichere und gesunde Drogenpolitik